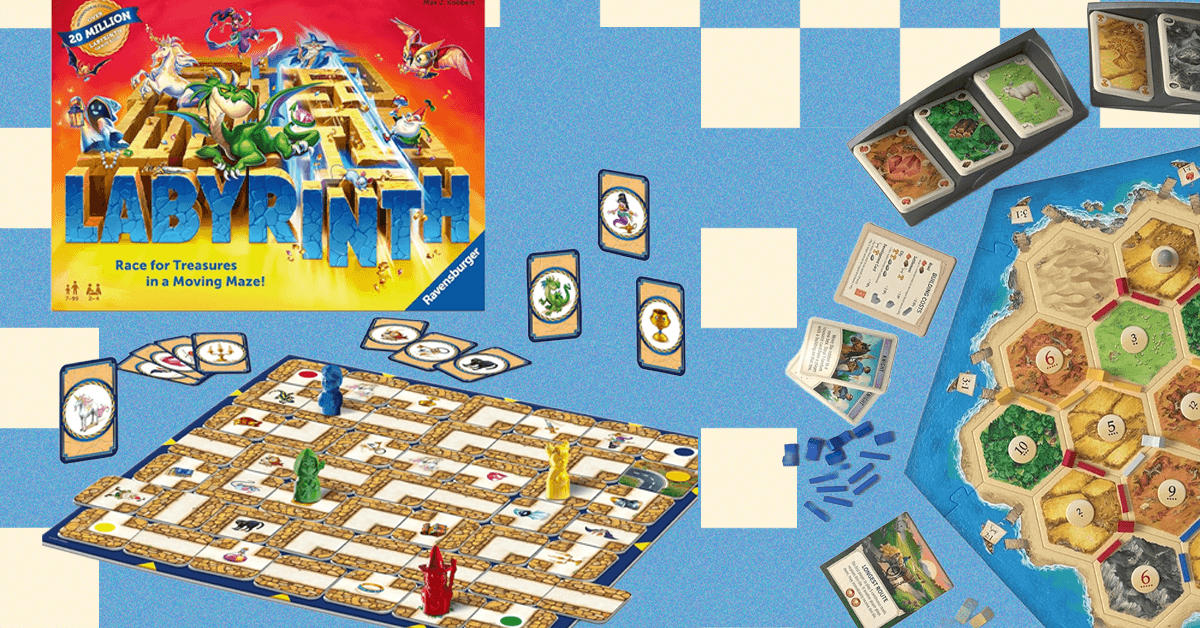Endlich gibt es Mittel gegen RS-Viren. Erste Erfahrungen aus dem echten Leben bestätigen: Sie wirken

Für Neugeborene kann eine Infektion mit dem Respiratorischen Synzytial-Virus (RSV) schnell gefährlich werden. Seit der letzten Wintersaison sind erstmals schützende Arzneimittel verfügbar.

Peter Collins / NIAID / CC BY 2.0
Für frischgebackene Eltern und ihren Nachwuchs ist die erste Infektion mit dem Respiratorischen Synzytial-Virus (RSV) immer eine Prüfung: Der Säugling fiebert und hustet, die Nase läuft, und an Schlaf ist für die ganze Familie tagelang kaum noch zu denken. Vermeiden lässt sich das kaum: Im Winter ist RSV wie andere Erkältungsviren fast allgegenwärtig, zwei Drittel aller Neugeborenen machen die Infektion im ersten Lebensjahr durch.
NZZ.ch benötigt JavaScript für wichtige Funktionen. Ihr Browser oder Adblocker verhindert dies momentan.
Bitte passen Sie die Einstellungen an.
Im Gros der Fälle geht der Spuk schnell wieder vorbei und bleibt ohne Folgen. Doch manche Säuglinge erwischt RSV schwerer. Dann wandert die Infektion von Rachen und Hals hinab in die Bronchiolen, die kleinsten Verzweigungen der Bronchien in der Lunge. Dort lässt die Reaktion des Immunsystems auf den Eindringling das Gewebe anschwellen, die Atemwege verengen sich.
Eine solche Bronchiolitis kann dazu führen, dass die Lunge nicht mehr ausreichend Sauerstoff aufnimmt. Zudem trinken die hustenden Kinder oft nicht genug. Ein bis zwei Prozent der Betroffenen landen deshalb im Spital. Todesfälle sind in Industrieländern dank guter medizinischer Versorgung sehr selten, kommen insbesondere bei Kindern mit Vorerkrankungen aber vor. Weltweit sterben jährlich rund 100 000 Kleinkinder an einer RSV-Infektion.
Gefährdet sind vor allem die ganz Kleinen«RSV ist sehr eindrücklich eine Gefahr für das Kind in seinem ersten Winter», sagt der Impfexperte Christoph Berger, Chefarzt der Infektiologie am Zürcher Kinderspital. Dabei gelte: Je jünger das Kind, desto grösser das Risiko. «Deshalb sind Herbstkinder auch stärker gefährdet als Frühjahrskinder.»
Seit kurzem stehen in Europa nun erstmals zwei neue Impfstoffe zur Verfügung, um Neugeborene vor solchen schweren Verläufen zu schützen. Nun, da die nächste Welle von RSV und anderen winterlichen Atemwegsinfektionen ansteht, stellt sich die Frage: Was sind das für Impfstoffe, und wie waren die ersten Erfahrungen der letzten Saison?
Die Medizin kennt das RS-Virus schon seit den 1950er Jahren. Doch ein früher Anlauf für die Entwicklung eines Impfstoffs in den USA scheiterte spektakulär: Die chemisch inaktivierten Viren im Vakzin führten bei einer späteren Infektion nicht zum Schutz, sondern zu einer überschiessenden Reaktion des Immunsystems mit besonders schweren Krankheitsverläufen. 1967 mussten wegen dieser «enhanced RSV disease» 80 Prozent der im Rahmen von Studien geimpften Kinder im Spital behandelt werden, zwei kleine Buben starben.
Die Forschung erholte sich lange nicht von diesem Rückschlag. Später verlegte sie sich auf einen anderen Ansatz: passive Immunisierungen. Dabei regt man nicht wie bei einer aktiven Impfung das Immunsystem zu einer eigenen Abwehrreaktion an, sondern injiziert fertige Antikörper, die das Virus neutralisieren sollen.
Der alte Antikörper eignet sich nicht für alleNach diesem Prinzip funktioniert auch der künstliche Antikörper Palivizumab. Er kam 1999 auf den Markt und war lange die einzige Option, Kinder gegen eine RSV-Infektion zu immunisieren. Allerdings ist Palivizumab teuer, und die Injektion muss während der RSV-Saison alle vier Wochen wiederholt werden. Darum ist er nur für vorerkrankte Kinder mit besonderem Risiko zugelassen.
Zu den passiven Immunisierungen gehört auch der neue, seit letztem Jahr in Europa erhältliche Antikörper Nirsevimab (Handelsname: Beyfortus). Er wird im Körper sehr viel langsamer abgebaut als sein Cousin Palivizumab. Dadurch bleibt der Schutz einer Injektion etwa fünf Monate lang wirksam – das reicht für eine ganze RSV-Saison. Zudem kostet Nirsevimab mit knapp 400 Franken pro Dosis einen Bruchteil seines Vorgängers.
In der Schweiz und in Deutschland wurde Nirsevimab zur Saison 2024/25 von den Impfkommissionen empfohlen und kam erstmals im grossen Stil zum Einsatz. Die Erfahrungen sind positiv. Für Deutschland veröffentlichte das Robert-Koch-Institut (RKI) kürzlich erste Daten: Insgesamt halbierte sich die Zahl bestätigter Infektionen und Einweisungen ins Spital für Säuglinge im Vergleich zur Saison 2023/24; dasselbe galt für Einweisungen auf Intensivstationen.
In der Schweiz und auch in einigen weiteren Ländern Europas und den USA sehe es ähnlich aus, so Berger. Unter den kontrollierten Bedingungen klinischer Studien reduziert der Antikörper das Risiko für schwere Verläufe sogar um 88 Prozent.
Allerdings variiert das Ausmass von RSV-Wellen von Jahr zu Jahr – könnte der beobachtete Rückgang im letzten Winter also schlicht Folge eines Zufalls sein? Kaum, meint Berger. Denn die starke Abnahme sei selektiv nur bei Säuglingen zu beobachten gewesen. Ältere Kinder seien dagegen in beiden Wintern ungefähr gleich häufig erkrankt – die gesamte Welle sei also ähnlich gross gewesen.
Die Impfung für die MutterFast zeitgleich mit Nirsevimab kam 2024 als weitere Option der Impfstoff Abrysvo auf den Markt. Eigentlich handelt es sich dabei um einen von mehreren aktiven RSV-Impfstoffen, die in den letzten Jahren für ältere Erwachsene zugelassen wurden. Er enthält ein Oberflächeneiweiss des Virus, welches das Immunsystem zur Bildung sogenannter neutralisierender Antikörper anregt. Diese hindern bei einer späteren Infektion das Virus am Eindringen in die Zelle, lösen aber nicht die heftige Immunreaktion aus, die 1967 so grosse Probleme machte.
Abrysvo kann laut Zulassung auch werdenden Müttern verabreicht werden, in der Regel rund sechs Wochen vor der Geburt. Die von der Mutter gebildeten Antikörper gehen dann über die Plazenta in das Blut des Kindes über und bieten so einen mehrere Monate anhaltenden Nestschutz für das Neugeborene. Aus Sicht des Kindes handele es sich also auch bei diesem neuen Impfstoff um eine passive Immunisierung, so Berger. «Entweder macht die Firma die Antikörper. Oder die Mutter.»
Ob die Impfung der Mutter mit Abrysvo infrage kommt, hängt laut Berger vor allem vom Geburtstermin ab. «Nach der Geburt lässt der Nestschutz durch die Impfung der Mutter kontinuierlich nach. Bei einem Frühlingskind wäre er bis zum Herbst schon verschwunden.»
Die Immunisierung wurde von den Eltern gut angenommenGemäss Studien schützen beide Optionen ähnlich gut. Und beide Impfungen würden sehr gut vertragen, so Berger. Die Kosten werden in der Schweiz inzwischen auch von den Kassen übernommen. Allerdings gilt dies sowie die Impfempfehlung der Eidgenössischen Kommission für Impffragen (Ekif) für Abrysvo erst seit August 2025. Aus diesem Grund fehlt es noch an Erfahrungswerten aus dem letzten Winter.
Von der Immunisierung mit Nirsevimab machten in der vergangenen Saison auf Basis der Verkaufszahlen des Herstellers Sanofi rund 80 Prozent der Schweizer Eltern Gebrauch. Ähnlich sieht es in Deutschland aus: In einer noch nicht veröffentlichten Untersuchung des RKI gaben zwei Drittel von fast 500 befragten jungen Familien an, die Immunisierung genutzt zu haben.
Für eine neu zugelassene Impfung seien das gute Werte, findet Berger. «Ein kleiner Säugling, der hustet und nicht mehr richtig Luft bekommt – diese Vorstellung hat wohl viele Eltern motiviert.»
nzz.ch