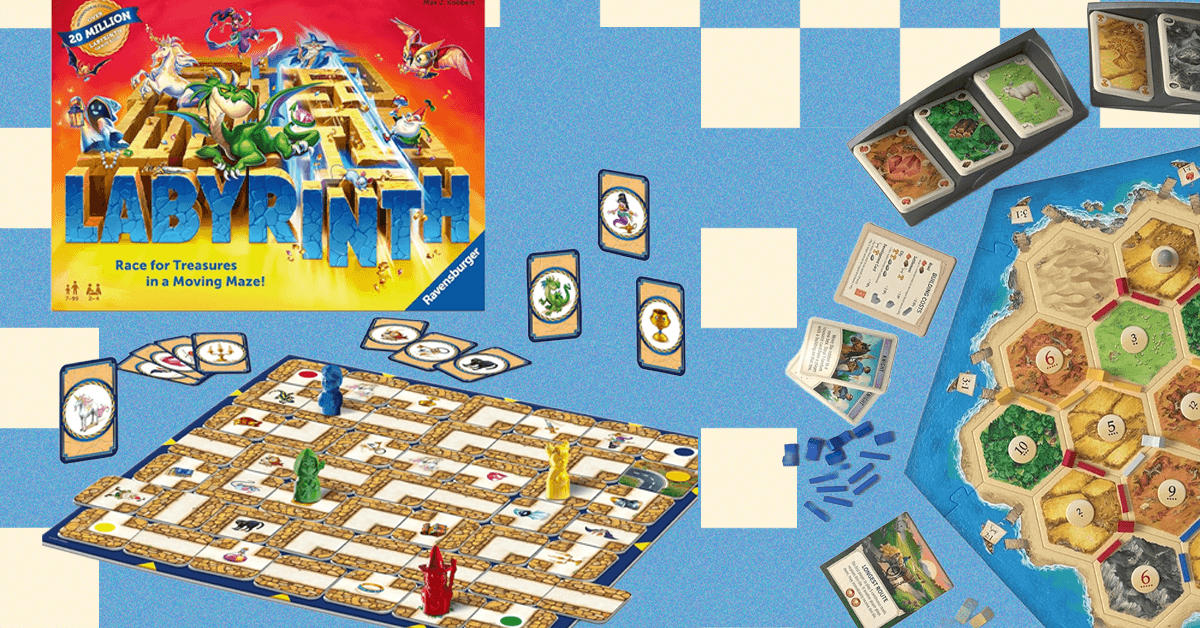Klimawandel erhöhte Hurrikan Melissa um das Vierfache, so eine Studie.

Dieser Artikel erschien ursprünglich auf Inside Climate News und ist Teil der Climate Desk -Kooperation.
Angetrieben von ungewöhnlich warmem Wasser, entwickelte sich Hurrikan Melissa diese Woche zu einem der stärksten jemals gemessenen Atlantikstürme. Eine neue Schnellanalyse legt nun nahe, dass der vom Menschen verursachte Klimawandel die Wahrscheinlichkeit für diesen verheerenden tropischen Wirbelsturm vervierfacht hat.
Hurrikan Melissa traf am Dienstag auf Jamaika und richtete auf der Insel schwere Verwüstungen an, bevor er über das benachbarte Haiti und Kuba hinwegfegte. Der Sturm, der die Kategorie 5 erreichte – die höchste Kategorie für Hurrikane mit extrem starken Winden –, hat in der Karibik bisher mindestens 40 Menschenleben gefordert. Mittlerweile zu einem Hurrikan der Kategorie 2 abgeschwächt, setzt er seinen Kurs auf Bermuda fort, wo er laut dem Nationalen Hurrikanzentrum voraussichtlich am Donnerstagabend auf Land treffen wird.
Erste Berichte über die Schäden sind verheerend, insbesondere im am schwersten betroffenen Westen Jamaikas. Winde mit Geschwindigkeiten von bis zu 300 km/h und sintflutartige Regenfälle zerstörten ganze Stadtviertel, verwüsteten große landwirtschaftliche Flächen und zwangen mehr als 25.000 Menschen – Einheimische wie Touristen –, in Notunterkünften oder Hotelsälen Schutz zu suchen. Laut einer neuen Studie des Imperial College London verstärkte der Klimawandel die Windgeschwindigkeiten von Hurrikan Melissa um 7 Prozent, was die Schäden um 12 Prozent erhöhte.
Experten zufolge könnten sich die Verluste auf mehrere zehn Milliarden Dollar belaufen.
Die Ergebnisse bestätigen ähnliche Berichte, die Anfang der Woche veröffentlicht wurden und den Einfluss der globalen Erwärmung auf die Wahrscheinlichkeit und Schwere des Hurrikans Melissa belegen. Jede dieser Analysen ergänzt die wachsende Zahl an Studien, die zeigen, wie die Erwärmung der Ozeane durch den Klimawandel die Bedingungen für stärkere tropische Stürme schafft.
Hurrikan Melissa sei „quasi ein Lehrbuchbeispiel dafür, wie Hurrikane auf den Klimawandel reagieren“, sagte Brian Soden, Professor für Atmosphärenwissenschaften an der Universität Miami, der an den jüngsten Analysen nicht beteiligt war. „Wir wissen, dass die Erwärmung der Ozeane fast ausschließlich durch den Anstieg der Treibhausgase verursacht wird.“
Der Sturm hat jeden Aspekt des Lebens in diesem Teil der Karibik beeinträchtigt.
„Es gab massive Zusammenbrüche bei den Hilfsangeboten. Menschen leben landesweit in Notunterkünften“, sagte Dennis Zulu, UN-Residentenkoordinator in Jamaika, am Mittwoch auf einer Pressekonferenz. „Unsere ersten Einschätzungen zeigen ein Land, das in einem noch nie dagewesenen Ausmaß verwüstet wurde.“
Der Zusammenhang mit dem KlimaFür die Schnellattributionsstudie nutzten die Forscher des Imperial College das von Fachkollegen begutachtete Imperial College Storm Model, bekannt als IRIS. Dieses Modell verfügt über eine Datenbank mit Millionen synthetischer tropischer Wirbelsturmbahnen, die dazu beitragen können, Wissenslücken darüber zu schließen, wie Stürme in der realen Welt funktionieren.
Das Modell simuliert im Wesentlichen die Wahrscheinlichkeit der Windgeschwindigkeit eines bestimmten Sturms – oft der schädlichste Faktor – in einem vorindustriellen Klima im Vergleich zum heutigen Klima. Durch die Anwendung von IRIS auf Hurrikan Melissa stellten die Forscher fest, dass die vom Menschen verursachte Erwärmung die Windgeschwindigkeit des Wirbelsturms um 7 Prozent erhöht hatte.
Das Modell legte nahe, dass ein so heftiger Hurrikan in der Region äußerst selten sei und in der kühleren Welt der vorindustriellen Vergangenheit wahrscheinlich nur einmal alle 8.000 Jahre in Jamaika auf Land treffen würde.
Bei der seither beobachteten Erwärmung – 2,3 Grad Fahrenheit – ist ein solcher Sturm laut der Studie nun nur noch alle 1700 Jahre zu erwarten.
Das Modell kann auch dazu beitragen, den direkten wirtschaftlichen Schaden an Sachwerten durch einen Sturm abzuschätzen. Es wurde festgestellt, dass mindestens 12 Prozent des wirtschaftlichen Schadens bei einer Katastrophe vom Typ Melissa im Vergleich zum vorindustriellen Ausgangsniveau auf den Klimawandel zurückzuführen sind.

Frauen waten am Dienstag nach dem Tod von Melissa in Barahona, Dominikanische Republik, durch die überfluteten Gewässer.
Foto: CARLOS FABAL/Getty ImagesIn der gesamten Karibik könnten sich die Schäden und wirtschaftlichen Verluste laut ersten Schätzungen des Wettervorhersageunternehmens AccuWeather auf bis zu 52 Milliarden US-Dollar belaufen. Für Jamaika, dessen Bruttoinlandsprodukt bei rund 20 Milliarden US-Dollar liegt, könnten solche Verluste jahrelang verheerende Folgen haben, so Ralf Toumi, Co-Direktor des Grantham Institute – Climate Change and the Environment am Imperial College London und Mitautor der Studie.
„Wenn auch nur eine dieser Zahlen der Wahrheit nahekommt, wird es für sie extrem schwierig werden, damit umzugehen“, sagte Toumi. „Ich hoffe, diese Zahlen sind falsch.“
Schnelle Klimaanalysen werden immer häufiger durchgeführt, da Wissenschaftler versuchen, Spekulationen und Fehlinformationen, die extreme Wetterereignisse oft auslösen, einzudämmen. Laut Soden kann diese Art der quantitativen Analyse dazu beitragen, die Auswirkungen des Klimawandels genau dann zu verdeutlichen, wenn die Menschen am meisten darüber nachdenken.
„Ich freue mich, dass sich immer mehr Gruppen dieser Art von Arbeit widmen“, sagte er. „Anstatt dass ich sage: ‚Ja, diese Dinge stimmen qualitativ mit unseren Erwartungen an ein sich erwärmendes Klima überein‘, können sie das mit Zahlen belegen. … Das hat, glaube ich, mehr Gewicht bei der Öffentlichkeit, Wissenschaftlern und politischen Entscheidungsträgern.“
Ein turbogeladener SturmHurrikan Melissa hat auf seinem zerstörerischen Weg durch die Karibik bereits mehrere Rekorde gebrochen. Er ist der stärkste Zyklon, der jemals Jamaika getroffen hat, und der intensivste jemals gemessene Sturm, der so spät in der Hurrikansaison im Atlantik auf Land traf.
Drei Tage vor dem Landgang durchlief der Hurrikan zwei Phasen rapider Intensivierung. Dieses Phänomen tritt auf, wenn die Windgeschwindigkeit eines Hurrikans innerhalb von 24 Stunden um mindestens 56 Kilometer pro Stunde zunimmt. Ursachen hierfür sind unter anderem warmes Wasser, geringe Windscherung und hohe Luftfeuchtigkeit.
Anfang dieser Woche zog Hurrikan Melissa langsam über ungewöhnlich warme Gewässer in der zentralen Karibik und gewann an Stärke, als er sich Jamaika näherte. Die Wassertemperaturen lagen 2,5 Grad Fahrenheit über dem Durchschnitt – Bedingungen, die laut einer Analyse der gemeinnützigen Wissenschaftsorganisation Climate Central durch den vom Menschen verursachten Klimawandel bis zu 700-mal wahrscheinlicher geworden sind.
Noch einzigartiger war, dass sich das warme Wasser tief unter die Oberfläche erstreckte und „eine enorme Menge an Energie lieferte, um den Hurrikan zu nähren“, sagte Brian Tang, Professor für Atmosphärenwissenschaften an der Universität Albany.
Während die US-amerikanische Wetter- und Ozeanografiebehörde NOAA und Forschungslabore weltweit die Zugbahn von Stürmen, wie beispielsweise Melissa, oft recht genau vorhersagen, gestaltet sich die Prognose einer rasanten Intensivierung deutlich schwieriger. Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass der Klimawandel die Wahrscheinlichkeit günstiger Bedingungen für eine solche Intensivierung erhöhen könnte.
„Aus wissenschaftlicher Sicht ist es erstaunlich, einen so starken Sturm im Atlantik zu beobachten“, sagte Tang und fügte hinzu, dass dies häufiger in den Gewässern vor Asien vorkomme, wo schwere Taifune wüten. Warmes Wasser liefere die Energie für die Stürme, was diesen Prozess sicherlich beschleunigt und verstärkt habe. Es handelte sich also nicht nur um eine rasante Intensivierung, sondern um eine extreme Form einer solchen.
Jamaika war am stärksten betroffen, doch viele Einwohner und Besucher hatten sich nach einer Woche voller Warnungen darauf vorbereitet, Schutz zu suchen. Behörden in Kuba meldeten Hauseinstürze, großflächige Überschwemmungen und ein erhöhtes Erdrutschrisiko. Haiti verzeichnete unterdessen mit mindestens 25 Toten die höchste Opferzahl.
Laut US-Außenministerium entsenden die Vereinigten Staaten Katastrophenschutzteams in die von Hurrikan Melissa betroffenen Karibikstaaten. Katastrophenexperten äußerten sich in den letzten Monaten besorgt über die Kürzungen der Trump-Regierung bei Hilfsorganisationen nach Katastrophen. In den Vorjahren koordinierte die US-Behörde für internationale Entwicklung (USAID) einen Großteil der Katastrophenhilfe in der Karibik. Die Trump-Regierung löste die Behörde jedoch rasch auf und schloss sie offiziell am 1. Juli .
Dana Sacchetti, Leiter des jamaikanischen Büros des Welternährungsprogramms, erklärte am Mittwoch gegenüber NPR , dass das Programm „vor Beginn der Hurrikansaison Anfang dieses Jahres Finanzmittel der US-Regierung sichern konnte, die entscheidend sein werden, um unsere Arbeit wieder aufzunehmen und den Betroffenen Nahrungsmittelhilfe zukommen zu lassen sowie nationale und regionale Hilfsmaßnahmen zu unterstützen.“ Er fügte jedoch hinzu, dass das Land zusätzliche Hilfe von Gebern und Regierungen benötigen werde.
Die New York Times berichtete, dass die „Hurricane Hunter“-Missionen der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) aufgrund des Regierungsstillstands mit kleineren Teams als üblich durchgeführt wurden. Ehemalige Mitarbeiter sprangen jedoch freiwillig ein, um die entstandenen Lücken zu schließen. Insgesamt stellte Tang während des Hurrikans Melissa keinen merklichen Rückgang der Genauigkeit der Vorhersagen fest, was seiner Meinung nach „das große Engagement der NOAA und dieser Bundesangestellten unterstreicht, die nicht nur ihre Arbeit erledigen, sondern auch die entstandenen Lücken füllen.“
Allerdings ist er besorgt über die Auswirkungen begrenzter Ressourcen und Personalstärke des Bundes auf die Hurrikanvorhersage in den USA.
„Die Bundesangestellten stehen unter enormem Stress, und ich mache mir Sorgen, wie lange sie das noch durchhalten können“, sagte er. „Zwar gab es in dieser Saison meines Wissens noch keine Ausfälle bei den von ihnen erbrachten Dienstleistungen, aber ich bin besorgt für die Zukunft. Wenn ein System so stark beansprucht wird, steigt das Risiko eines Ausfalls, insbesondere bei hohem Arbeitsaufkommen.“
wired