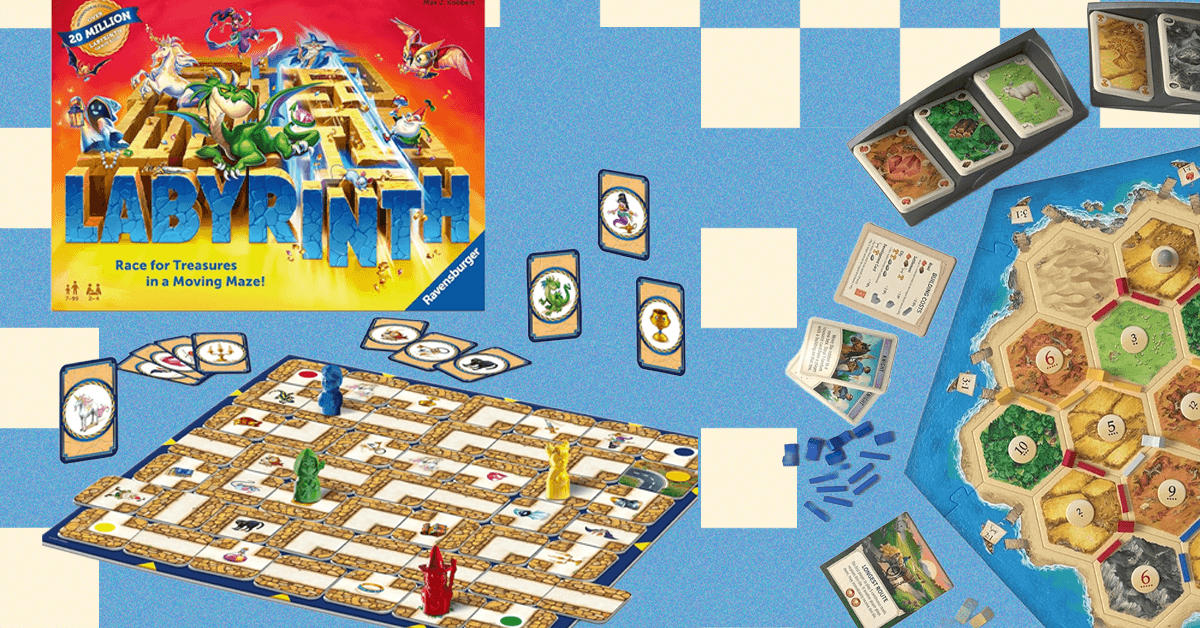Mit der Krankheit leben und lieben, solange es geht

Irgendetwas stimmt nicht mit seinem Körpergefühl, wenn er spazieren geht, dann schauen die Leute schon und tuscheln. Manchmal kann er hören, was sie sagen, keine ganzen Sätze, aber Wörter. «Betrunken», «Suffkopf», «Alki», so etwas. Dabei waren das Einzige, was er an solchen Tagen getrunken hatte, sein Espresso und etwas Wasser. Aber gut, wird schon wieder, manchmal macht der Körper eben Sachen, die man nicht versteht. Und er ist schon 40, da passiert ja einiges bei einem Mann – weniger Testosteron, weniger Sehkraft, schlechtere Verarbeitung von Koffein und Nikotin. Vielleicht sollte er weniger rauchen?
NZZ.ch benötigt JavaScript für wichtige Funktionen. Ihr Browser oder Adblocker verhindert dies momentan.
Bitte passen Sie die Einstellungen an.
Er kauft sich einen Gehstock. Nicht weil er ihn zum Gehen braucht, sondern damit die Leute endlich aufhören zu reden. Lieber sollen sie denken, er sei behindert als besoffen. Es wird nicht besser. Im Gegenteil. Er kann spüren, wie seine Zunge schwerer wird, gerade die Sprache, für ihn als Regisseur eines seiner wichtigsten Werkzeuge, wird zu einer Übung, die ihm immer seltener ohne Patzer gelingt. Er beginnt zu lallen.
Sogar seine Frau sagt jetzt: «Sag mal, geht’s noch?» – «Was?», fragt er dann. – «So früh am Tag», faucht sie, «und jetzt schon betrunken?»
Sie müsste es doch besser wissen. Klar, er geniesst einmal ein Glas Wein oder zwei, aber immer nur am Feierabend, und er übertreibt nie so, dass er derart die Kontrolle verliert. So einer ist er nicht.
Er muss zum Arzt. Von allein, da ist er sich jetzt sicher, wird es nicht wieder besser. Also vereinbart er einen Termin.
DanielleSchon die zweite Sehnerventzündung. Kann diese Plage nicht endlich aufhören? Kaum noch etwas zu erkennen – das ist auch dann schlimm, wenn man weiss, dass dieser Zustand wieder vorbeigeht. Aber da ist noch mehr. Manchmal ist ihr Bauch taub, dann ihr Rücken, dann sind da auch diese Schmerzen, die kommen und gehen, und egal, wie sehr sie versucht, Gründe zu finden, weder die Taubheit noch die Schmerzen folgen irgendeiner Regel. Sie sind einfach da. Und dann, ganz plötzlich, wieder verschwunden. Mit 31 fühlt sie sich an manchen Tagen wie eine alte Frau.
Sie geht also zum Arzt, schildert, was da passiert mit ihrem Körper. Der Arzt hört zu, nickt, stellt Fragen, gibt ihr schliesslich einen Zettel in die Hand, eine Überweisung an eine Klinik – sie solle sich dort einmal durchchecken lassen, sagt er. Auf dem Zettel liest sie: «Verdacht auf multiple Sklerose».
Multiple Sklerose – MS. Sie war noch ein Kind, da bekam eine Bekannte ihrer Mutter diese Diagnose. Die Bekannte hat immer weiter abgebaut, konnte irgendwann nicht mehr gehen, später kaum noch sprechen. «Die schlimmste Krankheit, die es gibt», hat Danielle damals gedacht. Darum geht es jetzt also.

Der Arzt bemerkt etwas an ihrem Gesichtsausdruck. «Na», fragt er, «da sind Sie jetzt wohl geschockt?» Sie sagt: «Ja.»
In der Klinik bestätigt sich der Verdacht, im MRT leuchten einige Stellen ganz hell, vor allem nahe ihrer Hirnrinde, dem Hirnstamm und im Rückenmark. Hell, das sind durch multiple Sklerose verursachte Nervenschäden. Bei MS verwechselt das Immunsystem die Schutzhüllen um die Nervenfasern in Gehirn und Rückenmark mit einem Feind – es greift die Schaltstellen des eigenen Körpers an, bis es sie zerstört.
Nach der Klinik fährt sie zu ihrer Mutter. Sie klingelt an der Tür, die beiden umarmen sich. Sie sagt: «Mama, es hat sich bestätigt. Ich habe MS.»
Die Mutter fängt an zu weinen.
«Mama, sei nicht so traurig», sagt sie, «besser, dass es mich getroffen hat als dich.»
OlliMit seiner Frau und ihm funktioniert es nicht mehr, seit er die Diagnose hat. «Das ist nicht wahr», hat sie immer wieder gesagt, «du hast keine MS.» Sie haben sich getrennt. Olli ist sich sicher, dass ihr Leugnen auch ein gutes Zeichen war dafür, dass da echte Gefühle waren. Seine Partnerin konnte die Vorstellung nicht aushalten, dass er, ihr Olli, diese Krankheit hat. Sie wollte sich schützen.
In den Wochen und Monaten danach fährt er in eine Spezialklinik in Bayern, die besonders gut sein soll für die Behandlung von MS-Patienten.
Als er durch die Flure geht, ist da vor allem ein Gedanke: «O Gott, ich werde auch einmal so.» Zwei Drittel der Patienten sind Rollstuhlfahrer, viele brauchen lange, um einen Gedanken zu formulieren, bei einigen funktioniert das Sprechen nicht mehr richtig. Er hört von Inkontinenz, dass Leute ihren Stuhl nicht mehr halten können. Und er erfährt von zwei Dingen, die in dieser Klinik immer wieder passieren:
Menschen bringen sich um. Multiple Sklerose ist eine Krankheit, die den Betroffenen die Kontrolle über das eigene Leben nimmt – am Anfang fallen meist das Gehen und das Stehen schwer, später das Halten von Gegenständen, dann das Sprechen, schliesslich das Atmen. In den letzten Stadien sind Patienten auf Hilfe angewiesen, falls sie ihrem Leben ein Ende setzen wollen. Die Klinik aber steht in Deutschland, in der Nähe von München, und nach deutschem Gesetz ist dieser Ausweg verboten. Also springen manche Patienten bei sich zu Hause vom Balkon. Gesundheitlich hätten sie vielleicht noch Monate, vielleicht noch Jahre an Lebenszeit vor sich, so genau weiss das bei neurodegenerativen Krankheiten niemand. Aber besser rechtzeitig gehen, solange sie noch selbst entscheiden können. «Ich muss schauen», nimmt Olli sich vor, «dass ich rechtzeitig den Absprung schaffe.»
Menschen verlieben sich aber auch in dieser Klinik. Wenn man nichts erklären muss, weil die andere Person weiss, was mit einem passiert, entsteht eine besondere Form von Verbundenheit. Olli kommt mit einer anderen MS-Patientin zusammen. Nur bekommt sie eine weitere Diagnose: Bauchspeicheldrüsenkrebs. Sie stirbt.
Olli wird die Klinik daraufhin drei Jahre lang meiden. So lange, bis der Arzt sagt, seine MS-Symptome verschlimmerten sich zu sehr, er sollte wieder in die Klinik. Olli stimmt zu.

Sie sitzt im Raucherpavillon der Klinik, ganz hinten in einer Ecke, und fragt sich, was das alles soll. Sie ist jetzt 46 und arbeitslos, zumindest empfindet sie es so, auch wenn ihr offizieller Status Rente heisst, wegen der Krankheit. Auf den Fluren ist sie älteren Patienten begegnet, die ihr vorwerfen, sie gehöre gar nicht hierher. «Spiel dich doch nicht so auf», hat ein Mann gesagt, «wo hast du denn MS? Du kannst doch sogar noch gehen.»
Sie hat verheulte Augen, auf die sie hier niemand anspricht. Alle wissen ja, warum Menschen hier manchmal weinen. Immerhin, das Nikotin in der Lunge beruhigt.
Es ist schon Abend, halb acht, da rollt ein Neuling zum Raucherpavillon. Sie kann nicht sagen, warum, aber irgendetwas ist mit diesem Mann im Rollstuhl. Sie kann nicht mehr wegsehen, sucht Augenkontakt. Aber warum eigentlich? Warum sollte sich jemand mit dieser Ausstrahlung für sie interessieren? Oder mit ihr reden? Nein. Mit ihr bestimmt nicht.
OlliNach der ersten, vielleicht auch der zweiten Zigarette muss er auf die Toilette. Auf dem Weg denkt er an die Frau da draussen im Raucherpavillon. Sie hatte so traurige Augen. Was ist nur mit ihr passiert?
Auf dem Rückweg steht sie plötzlich vor ihm, mitten im Klinikflur. Sie schaut ihn an in seinem Rollstuhl und fragt: «Wer bist du denn?» Er antwortet: «Der Olli.»
«Olli? Also Oliver?»
«Lieber Olli. Oliver habe ich immer nur von meinen Eltern gehört – dann hatte ich gerade was angestellt. Aber ich bin schon trotzdem ein Schlawiner.»
«Wieso?»
«Ich war schon dreimal verheiratet.»
Die Frau lacht. «Und du?», fragt er.
«Ich bin die Danielle.»
DanielleDer Olli redet also doch mit ihr. Jetzt sitzen sie im Gemeinschaftsraum der Klinik, und eines der ersten Dinge, die sie tauschen, sind ihre Telefonnummern. Dann geht es weiter, sie sprechen über die Krankheit, darüber, wie es bei ihnen begonnen hat, wie es weitergegangen ist, wie es jetzt ist und was wohl noch passieren wird. Und Olli fragt sie, warum sie so traurige Augen habe. «Bin ich denn immer noch so verheult?», fragt sie ihn. «Nein», antwortet er, «aber vorhin, im Raucherpavillon, hatte ich das Gefühl, durch deine Augen in deine Seele zu sehen.»
Andere würden solche Sätze vielleicht kitschig finden, und bei jemand anderem ginge es Danielle vielleicht auch so. Aber bei Olli hat sie das Gefühl, dass da wirklich etwas ist. Dass sie ehrlich gesehen wird. Endlich einmal.
OlliDie Sache war eigentlich schon beim Raucherpavillon klar gewesen. Nach diesen zu kurzen Stunden im Gemeinschaftszimmer sind da keine Zweifel mehr. Er wäre gern geblieben, aber acht, neun Stunden mit dem Zug an diesem Tag hatte er schon hinter sich, und dann war es irgendwann auch so spät. Er musste ins Bett. Einer seiner letzten Gedanken, bevor er einschläft: Ich habe mich verliebt.
DanielleSie sitzt in ihrem Zimmer und starrt auf die Google-Ergebnisse. Olli ist Regisseur. Ein Kreativer, der schon rund um die Welt für seine Arbeit ausgezeichnet wurde. Ein erfolgreicher, wacher Geist. Der Mann spielt in einer ganz anderen Liga als sie, die gelernte Kauffrau für Mode- und Sportbekleidung, die trotz Ausbildung gerade niemand mehr anstellen will. Sie denkt: Arbeitslos und durch die Krankheit aussichtslos – wer soll mich denn überhaupt lieben? Jemand wie der Olli ganz sicher nicht. Da sollte sie sich nichts vormachen.
OlliIn den Tagen nach ihrer Begegnung im Gemeinschaftsraum haben Danielle und er jeden Tag mehrere Stunden lang gesprochen. Und trotzdem ist da eine Mauer, so ganz will sie ihn nicht heranlassen – oder besser: hineinlassen, in die Seelenwelt dahinter.
Und dann muss sie abreisen. Sie war ja schon vor ihm in der Klinik, im Durchschnitt bleibt ein Patient drei Wochen. Er hilft ihr mit dem Gepäck. Zum Abschied fragt er nach einer Umarmung. Ein paar Sekunden lang drückt er sie an sich, und sie erwidert diesen angenehmen Druck. Er küsst den Rücken ihrer rechten Hand.


Noch nie hat sie so etwas erlebt. Ein Handkuss zum Abschied! Der Olli ist so elegant. Aber wie er gezittert hat. Als er aus dem Rollstuhl aufgestanden ist, hat seine Krankheit durchgeschlagen. Für einen Moment war sie in Sorge – wie kann er bei diesem heftigen Zittern denn stehen?
Und jetzt will er telefonieren. Darum hat er beim Abschied gebeten. Aber will sie das denn? Mit Männern hatte sie noch nie viel Glück. Und sowieso, MS und MS, das passt nicht. Dem anderen dabei zusehen, wie es einem selbst ergehen wird? Nein. Das kann sie nicht. Das will sie nicht.
Zu Hause bekommt sie schon nach fünf Tagen einen Schub, die Symptome zeigen sich besonders schlimm. Der Arzt sagt ihr: «Entweder eine ambulante Cortisontherapie oder, und das wäre besser, noch einmal in die Klinik.» Für sie ist klar: «Ich gehe zurück in die Klinik.»
OlliDa ist sie wieder. Danielle. Ausgerechnet jetzt, wo er am nächsten Tag doch eigentlich schon gehen muss. Er spricht mit den Ärzten, fragt, ob er seine Entlassung noch etwas hinausschieben darf. Sie erlauben ihm einen weiteren Tag. Er versucht, sein Zugticket zu stornieren. Zu spät. Egal. Was ist schon Geld, wenn es um die Liebe geht?
An den zwei Tagen, die ihnen gemeinsam bleiben, reden sie wieder stundenlang. Dann reist er ab.
Diesmal gibt es zum Abschied keinen Handkuss und auch keine Umarmung.
DanielleEr will unbedingt telefonieren. Aber sie will das nicht. Zumindest nicht, solange sie noch in der Klinik ist, dort sind die Wände so dünn. Und ausserdem, zwischen Olli und ihr, da ist doch nichts.
Aber er lässt nicht locker, fragt immer wieder nach. Und einen Tag vor Weihnachten sagt sie dann doch einmal: «Okay.»
Das erste Telefonat dauert drei Stunden. Das zweite vier. Das dritte noch länger. Sie telefonieren jeden Tag, so lange, bis Danielle das Gespräch beendet und ruft: «Time out!»
Und dem Olli, dem reicht das nicht. Der will nun auch zu Besuch kommen. Nicht in der Klinik, bei ihr daheim. An Silvester. «Nein», sagt sie, «lieber nicht.»
Und dann schaut sie selbst nach Zugverbindungen. Nicht zu Silvester, aber für die Zeit danach. Bucht man einen Monat im Voraus, sind die Verbindungen günstig, nur 29 Euro durch ganz Deutschland. Soll sie? Sie ruft ihre Mutter an, fragt: «Mama, was soll ich denn jetzt machen?» Die Mutter sagt nur: «Ja, fahr doch!»
OlliDanielle ruft an. «Am 18. Februar 2018», sagt sie, «da komme ich zu dir!» Der Zug sei schon gebucht, nur die Hinfahrt, die Rückfahrt sei offen – damit sie jederzeit abreisen kann, wenn es nicht funktioniert. Er grinst und sagt ihr, dass er sich freue.
Olli und DanielleJuli 2025: Danielle ist 54, Olli 58, sie wohnen jetzt zusammen. «Seit meiner Zugfahrt vor sieben Jahren waren wir keine zwei Wochen mehr ohne einander», sagt Danielle. Die beiden teilen sich eine Wohnung in der Nähe von München, kleine Terrasse, grosses Wohnzimmer, in jedem Raum hängen Bilder und Skizzen von Olli, der nicht nur Regisseur ist, sondern auch Künstler. Danielle sagt, sie schaue sie so gerne an. Olli sagt, Danielle sei der wichtigste Rückhalt für seine Kunst.
Bevor sie zusammengezogen sind, lebte Olli am Meer. Er mag die Weite der flachen Landschaft von Norddeutschland und wollte bis auf die Klinikbesuche eigentlich nie wieder in den Süden, vor allem nicht nach Bayern, die Welt dort unten erlebt er als viel enger. «Aber gut, dann kam eben Danielle», sagt er und grinst sie aus seinem Rollstuhl heraus an. «Du, ich wollte auch nie wieder in den Norden fahren. Und vor allem nicht mehr als acht Stunden in einem Zug sitzen – für einen Mann. Das hatte ich mir geschworen», gibt Danielle zurück. «Und für dich hab ich mich dann doch in den Zug gesetzt.»
Wenn sie über ihr Zusammenleben sprechen, sagt er: «Unsere Beziehung kann man als eheähnliche Verbindung bezeichnen. Oder als ziemlich beste Freundschaft.» Sie sagt: «Wir kennen einige Leute, die haben in der Klinik geheiratet.»
Ihren Nachnamen und den genauen Wohnort wollen beide nicht in einem Zeitungsbericht lesen. «Da ist nichts, wofür wir uns schämen, aber es gibt Leute da draussen, die muss man auch nicht füttern», sagt Danielle. Olli nickt. «Neulich habe ich auf der Terrasse gesessen und eine geraucht, in meinem Rolli. Da sind Leute vorbeigekommen, und einer hat ganz angeekelt gerufen: ‹Igitt, da sitzt ja ein Behinderter.›»

«Mit unserer Krankheit gibt es noch viel Stigma», sagt Danielle.
«Ja», sagt Olli, «MS-Patienten brauchen doch keine Beziehung mehr.»
Und tatsächlich ist die Beziehung der beiden etwas ungewöhnlich organisiert: Sie haben einen WG-Mietvertrag und führen offiziell getrennte Haushalte, auch mit getrennten Bädern. Ihre Motivation für das Zusammenziehen, sagen beide, sei auch gewesen, sich gegenseitig zu unterstützen.
Olli macht es nichts aus, stundenlang am Schreibtisch zu sitzen, Anträge fürs Sozialamt zu schreiben und nach Förderungen zu suchen, die auf ihre Situation zutreffen könnten – eine zentrale behördliche Stelle, die Bescheid weiss, gibt es nicht. Beim Kochen hingegen hat er Probleme; am Herd stehen, Hitze spüren, das verschlimmert seine Symptome.
Danielle hat keinen Sinn dafür, sich durch Aktenordner zu arbeiten und die komplexen Gesetzestexte so zu übersetzen, dass ein normaler Mensch sie versteht. «Patientenverfügungen und so was, da bekomme ich sofort Panik.» Sie kocht gerne und backt, mag die kleinen Freuden, die Genuss in den Alltag bringen. Mal ein Espresso, mal ein Eis, mal ein selbstgebackener Kuchen oder eine Torte, dazu ein warmes Mittagessen, das ist, womit sie andere beschenken will. «Es freut mich jedes Mal, wenn andere sagen, dass es ihnen schmecke», sagt sie. «Und dem Olli schmeckt es immer. Als er allein gewohnt hat, musste er immer ins Restaurant rollen, um etwas Warmes zu essen.»
Olli nickt. «So haben wir uns das aufgeteilt. Ich mache Bürokram. Das notwendige Übel, wenn man so will. Und sie ist für all das zuständig, was guttut und schmeckt und was man geniessen kann. Sie kümmert sich um das, was uns hilft.»
Was ist, wenn einer nicht mehr will?Es gibt verschiedene Formen der multiplen Sklerose. Alle gehören zu den sogenannten vorpalliativen Erkrankungen. Das heisst, durch die Krankheit ist ein gewisser Verlauf der Symptome hin zum Tod vorgezeichnet. Da aber jede multiple Sklerose anders verläuft, bleiben mit entsprechender Behandlung oft noch viele Jahre, bis es mithilfe von Palliativmedizin darum geht, das Ende des Lebens möglichst gut zu gestalten.
Die primär-progrediente multiple Sklerose: Die Symptome beginnen eindeutig und werden vom ersten Auftreten an kontinuierlich schlimmer.
Die schubförmig-remittierende Form beginnt mit Krankheitsschüben, die den Körper überschwemmen wie Wellen: Plötzlich sind sie da, heftig, nehmen alles für sich ein. Und dann, mal nach Stunden, mal nach Tagen, ziehen sie sich wieder zurück – Patienten erholen sich teilweise wieder vollständig.
Die sekundär-progrediente Ausprägung beginnt ebenfalls mit solchen Schüben. Aber mit zunehmendem Alter erholt sich der Körper immer weniger. In der Tendenz wird es kontinuierlich schlechter.
Olli und Danielle kennen das mit den Schüben. Wenn für ein paar Tage alles ganz schlimm ist, bekommen sie Angst: Was, wenn es jetzt so bleibt? Bisher wurde es jedes Mal auch wieder besser. Aber nur noch selten wird es wieder ganz gut.
Was sie in der Klinik erlebt haben, die anderen Patienten, deren Verläufe, das haben sie nun zu Hause: Am Verlauf des anderen können sie beobachten, was sie selbst womöglich bald erwartet, vielleicht erst in Jahren oder Monaten, vielleicht aber auch schon in ein paar Wochen oder Tagen.

Olli braucht nicht immer, aber schon seit langem häufig einen Rollstuhl. Bei Danielle fängt dieses Symptom jetzt an. «Vor ein, zwei Wochen war das Gehen noch kein Problem», sagt sie. «Da ging das super!» Mittlerweile hat auch sie einen Rollstuhl daheim, auch wenn sie noch immer darauf besteht, zumindest kleine Strecken zu Fuss zu schaffen, in die Küche oder auf die Terrasse.
«Wir sind in allem offen miteinander, sobald etwas nicht mehr geht», sagt Danielle. «Alles andere wäre egoistisch», sagt Olli, «der andere muss wissen dürfen, was irgendwann womöglich auch auf ihn zukommt.»
Was auf den anderen zukommt, damit meint Olli zwei Dinge: Zum einen sind da die Krankheit und ihre Symptome. Und zum anderen ist da die Frage, was passiert, wenn einer von beiden irgendwann nicht mehr will.
«Solange ich selbst aufs Klo gehen und mir Hilfe holen kann, so lange ist es gut», sagt Olli. «Aber wenn ich merke, das geht nicht mehr . . . – Dann würde ich lieber gehen.»
«Und das finde ich in Ordnung», sagt Danielle. «Sobald man mich in Windeln packen müsste, ist das für mich unwürdig. Andere dürfen das anders sehen. Aber ich will das nicht, mich wieder so fühlen wie ein kleines Kind.»
Verantwortung füreinander ist in jeder Beziehung wichtig. Üblicherweise übernimmt man Verantwortung für das gemeinsame Leben. Bei Danielle und Olli geht die Verantwortung weiter, sie erstreckt sich darauf, es zu akzeptieren, vielleicht sogar darauf, es möglich zu machen, wenn der andere sagt: Ich will jetzt sterben. Wie aber lässt sich über solche Dinge reden, gerade mit dem Menschen, den man liebt?
Danielle: «Ne, das haben wir bisher nicht. Aber wir haben darüber geredet, wie wir beerdigt werden wollen. Einmal Sarg, einmal Urne.»
Olli: «Bei mir ist es die Urne. Ich bin eher pragmatisch unterwegs. Friedhöfe und so, dass dort etwas zurückbleibt, das ist nicht so meins.»
Danielle: «Ich finde es schrecklich, einer Urne hinterherzulaufen. Das hatte ich bei meiner Oma. Staub und Asche – und das soll meine Oma sein?»
Olli: «Derjenige, der noch da ist, muss genau das tun, was er doch eigentlich nicht möchte. Danielle müsste hinter einer Urne herlaufen und ich hinter einem Sarg.»
Beide lachen.
Olli: «Das ist schon eine Ironie.»
Danielle: «Aber da lachen wir beide drüber. So sind wir.»
Weniger Tage, mehr LebenBeide sitzen da, am Esstisch im gemeinsamen Wohnzimmer, Olli in seinem Rollstuhl, Danielle auf einem Holzstuhl, und schauen sich nach ein paar Sätzen jeweils an. Bei anderen Menschen entstehen solche Blicke häufig aus Angst, etwas Falsches gesagt zu haben, oder aus dem Wunsch heraus, bestätigt zu werden. Bei Danielle und Olli wirkt dieser Austausch von Blicken anders, verspielter, wie eine Einladung dazu, die Striche dieser Lebensskizze zu ergänzen, die nur mithilfe des anderen wirklich echt werden kann.
«Gerade ist es doch etwas viel», sagt Olli. «Wir können ja eine kurze Pause machen», sagt Danielle. Sie gehen auf die Terrasse, um eine zu rauchen.
Die britische Krankenschwester und Gründerin der modernen Hospiz- und Palliativbewegung Cicely Saunders hinterliess den Satz: «Es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage zu geben, sondern den Tagen mehr Leben.»
Und vielleicht ist es das, was Olli meint, wenn er zwischen zwei Zügen an der Zigarette sagt: «Ich wünsche mir, dass die Krankheit nicht nur als etwas rein Negatives dargestellt wird.» Ja, multiple Sklerose nimmt ihm und Danielle viele Dinge, im Vergleich zu einem gesunden Menschen auch viele Lebenstage, «aber dafür sehe ich jetzt mehr», sagt Olli. «Ich gehe langsamer oder rolle teilweise. Und dadurch beschäftige ich mich länger mit etwas, was ich sonst übersehen würde.»
Warum brennt in einem Fenster spätabends noch Licht? Warum schmeckt die gleiche Marzipantorte von derselben Konditorei in Lübeck an jedem Tag ein bisschen anders? «Darüber denke ich jetzt nach», sagt Olli. «Ja, das ist bei mir ähnlich», sagt Danielle, «die Sinne sind anders geschärft, wenn einem bewusst ist, dass es irgendwann ein Ende hat.»
Während immer mehr Longevity-Center gegründet werden und es längst zum Mainstream gehört, Kalorien zu zählen und über Elektrolyte und Entgiftung zu reden, sitzen da zwei Menschen mit einer lebensverkürzenden Erkrankung und geniessen es, gemeinsam auf der Terrasse zu sitzen und zu rauchen.


Immer wieder fragen Ärzte und Pfleger auf Palliativstationen ihre Patienten, was es denn für sie bedeute, «den Tagen mehr Leben zu geben». Einer will noch ein Stück vom Zwetschgenkuchen seiner Mutter. Ein anderer möchte mit seiner Tochter öfter mal ein Glas Wein trinken. Eine Frau will mehr Zeit im Garten verbringen, häufiger dösen auf der Liege unterm Apfelbaum, einfach so.
Danielle sagt, sie freue sich, wenn sie und Olli im Sommer Spaghetti-Eis ässen oder in den Ferien ein Stück Marzipantorte. Und einen Cappuccino dazu, das sei fein. Oder am Strand sitzen und aufs Meer schauen. Seelenruhe spüren. Auf der Terrasse wortlos eine Zigarette miteinander teilen. «Zusammen zu geniessen», sagt Danielle, «das ist das Schöne.»
Olli sagt, er möge es, wie ihre Freude auf ihn überschwappe. Und noch mehr, wenn es ihm gelinge, der Auslöser für dieses Gefühl zu sein, etwa durch eine kleine Überraschung wie einen Strauss Blumen. «Ich sehe dann, wie sie sich freut», sagt Olli, «und ich denke mir, eigentlich ist doch alles gut. Genau so, wie es gerade ist.»
«Aber ich bin manchmal schon auch eine Herausforderung», sagt Danielle.
«Ja, klar», sagt Olli. «Das mag ich.»
MS und MS: Das passtOlli sagt, mit niemandem sonst dürfe er sich so viele und müsse er sich so wenige Gedanken machen wie mit Danielle. «Da ist so eine Selbstverständlichkeit, dass wir offen über alles reden.» Egal, ob es um den Verlauf der MS geht, über Meinungen zu Politik, Ausstellungen, einen Film oder sonstige Dinge – Olli sagt: «Da ist ein Gleichgewicht.»
Einmal hatten die beiden beschlossen, ihre Patientenverfügungen vorzubereiten. Vor dieser Sache hat Danielle sich gefürchtet. Und Olli wusste das. Er hat sie an diesem Tag an die Hand genommen, wörtlich wie emotional. «Früher hätte ich nie gesagt, dass MS und MS passen. Ich wollte das nicht», sagt Danielle. «Aber jetzt erlebe ich die Augenhöhe. Ich muss niemandem etwas erklären. Das ist befreiend.»
Alle Menschen müssen sterben. Irgendwann. Wenn dieser Umstand aber fassbar wird, spürbar durch eine Krankheit, dann fühlt sich dieses «irgendwann» gar nicht mehr so weit weg an, an manchen Tagen mit einem besonders schweren Schub sogar ganz nah.
«Bei anderen ist da so viel ‹Vielleicht›», sagt Olli. Vielleicht ist heute der richtige Zeitpunkt dafür, Ja zu sagen zu einem Menschen, den man liebt, oder dafür, sich nach einem Streit wieder zu versöhnen, vielleicht aber auch erst morgen, vielleicht auch erst viel später – und vielleicht ist es irgendwann zu spät. «Wir leben jeden Tag in dem Wissen, dass es so kommt. Das eröffnet neue Perspektiven.»
Danielle nickt. Perspektiven, das sei ein gutes Wort. «Ich will gesehen werden. Wahrgenommen werden», sagt sie. «Im Raucherpavillon damals habe ich das erste Mal dieses Gefühl gehabt: Da ist jemand, der sieht.»
nzz.ch